Newsletter 01/2020
FIBER - Workshops 2020
In diesem ersten Newsletter 2020 wollten wir euch Mitte März eigentlich den Workshop «Die Ökologie von jungen Forellen – Jungfischlebensräume erkennen und schaffen» in diesem Frühjahr ankündigen – leider macht auch uns das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung und wir können diesen Frühling leider keine Veranstaltungen anbieten. Über eine Durchführung im Frühling 2021 wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Mit dem nötigen Optimismus freuen wir uns aber auf den Herbst/Winter 2020: Wir hoffen, dass wir dann wie geplant mit dem Klassiker «Laichzeit! Laichgruben von Forellen erkennen und kartieren» in allen drei grossen Sprachregionen unterwegs sein können.
Nun möchten wir euch aber den Rest des Newsletters nicht vorenthalten - Viel Spass beim Durchstöbern und vielleicht findet ihr unter den Publikationen etwas Spannendes um euch die lange Zeit ein wenig zu verkürzen! Wir hoffen, euch ab Herbst wieder persönlich bei unseren Veranstaltungen begrüssen zu dürfen und wünschen euch bis dahin eine möglichst gute Zeit.
Blibed gsund!
Eure FIBER
Rückblick FIBER-Seminar und Aqua Viva
Das sehr gut besuchte FIBER-Seminar 2020 «Fische in der Schweiz – gestern, heute, morgen» ist bereits Geschichte – unseren Rückblick findet ihr unten. Wie in den Jahren zuvor hat Aqua Viva (ehemals Rheinaubund, Gewässerschutzorganisation in Schaffhausen) die neuste Ausgabe ihrer Zeitschrift dem FIBER-Seminar gewidmet. Diese enthält von unseren Referentinnen und Referenten verfasste Zusammenfassungen ihrer Vorträge und gibt eine ausführliche Übersicht über den spannenden Tag in Olten.

Fisch des Jahres ist die Forelle
Ehre wem Ehre gebührt: Die Forelle ist der beliebteste Fisch der Schweiz - und einer der häufigsten. Doch er ist gefährdet, weil die Lebensgrundlagen nicht mehr stimmen. Darum hat ihn der Schweizerische Fischerei-Verband SFV zum Fisch des Jahres 2020 erkoren.

Publikationen
Revitalisierung kleiner und mittlerer Fliessgewässer – Ein Leitfaden für Praktiker
Die 2. Auflage des Leitfadens „Revitalisierung kleiner und mittlerer Fliessgewässer“ der Hochschule für Technik Rapperswil ist verfügbar. Er gibt Aufschluss über die Bedingungen und den Spielraum einer attraktiven, baulichen Gestaltung und vermittelt die Grundlagen der Bachentwicklung im Rahmen von Unterhalt und Pflege. Die Themen wie Beschattung, Erholung im Gewässerraum und Verwendung von Totholz werden vertieft abgehandelt. Der Leitfaden richtet sich an Fachkräfte der öffentlichen Hand und privater Unternehmen im Bereich Wasserbau sowie Gewässerpflege und -unterhalt.
Planungshilfe Engineered Log Jam (ELJ)
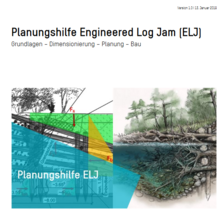
Das Handbuch, welches im Auftrag des Ranaturierungsfonds des Kantons Bern verfasst wurde, widmet sich den aus den USA stammenden «Engineered Log Jams», welche den ingenieur-biologischen Nachbau von natürlichen Stamm-verklausungen im Flussbau beschreibt. Untersuchungen an natürlichen Log Jams haben ergeben, dass die in sich verkeilten Strukturen erstaunlich dauerhaft sind, sich in natürlicher Umgebung mit einem entsprechenden Nachschub an Totholz durch den Prozess der Akkumulation laufend selbst erneuern können und sich deutlich positiv auf die Fischfauna auswirken (Brooks, et al., 2006). Einerseits soll mit dem vorliegenden Handbuch ein Verständnis für den grossen ökologischen und morphodynamischen Wert von massiven Totholzstrukturen in Fliessgewässern geschaffen werden. Dankenswerterweise kann hierzu auf den bereits vorhandenen Reichtum an wissenschaftlichen Arbeiten aus dem englischsprachigen Raum zurückgegriffen werden. Andererseits sollen konkrete Beispiele, Planskizzen und detaillierte Angaben zu Projektierung und Bau anregen, ELJs in weiteren Flussbauprojekten einzusetzen, wobei die Chancen und Grenzen dieser neuen Bauweisen transparent dargelegt werden.
Expertenbericht zur Erhebung von Quell-Lebensräumen
Der Bund möchte im Rahmen des Pilotprojekts «Dem Wert des Wassers auf der Spur» (Aktionsplan Biodiversität) gemeinsam mit den Kantonen das Wissen über die bedrohten und wenig beachteten Quell-Lebensräume verbessern. Angestrebt wird ein nationales Verzeichnis der Quell-Lebensräume. Nun liegt ein im Auftrag des BAFU verfasster Expertenbericht vor. Er schlägt erstens ein Verfahren zur systematischen und einheitlichen Erhebung von Daten vor und ergänzt zweitens die bisherige gewässerökologische Bewertungsmethode durch die naturschutzfachlich ausgerichtete Einstufung in eine nationale, regionale und lokale Bedeutung des Lebensraums.

Neues Handbuch für die Partizipation bei Wasserbauprojekten – Betroffene zu Beteiligten machen

Das Handbuch des Bundsamts für Umwelt richtet sich an Fachpersonen, welche in Kantonen, Gemeinden und Privatwirtschaft für die Planung von Wasserbauprojekten zuständig sind. Der Inhalt basiert auf praktischen Erfahrungen aus der Schweiz und dem benachbarten Ausland. Die Struktur des Handbuchs folgt dem zeitlichen Ablauf eines Projekts. Dem Handbuch kann somit Schritt für Schritt gefolgt werden. Oder aber es wird punktuell zur Klärung spezifischer Fragen für die Planung und Umsetzung beigezogen.
Der Klimawandel verändert die Durchmischung von Seen

Im Zürichsee wird schon länger beobachtet, was für viele tiefe Seen am Rande der Alpen bald Realität sein wird. Seit die Wassertemperatur dokumentiert wird, ist sie an der Oberfläche um ganze 4° C angestiegen. Ein neues Dossier des Bundesamts für Umwelt zum Thema Wasser zeigt nun, was dieser Temperaturanstieg für die Hydrologie eines ganzen Sees bedeutet. Bleiben die oberen Wasserschichten in milden Wintern zu warm, können sie sich nicht mehr mit dem kalten Tiefenwasser vermischen. Nicht nur im Zürichsee, sondern auch im Genfer- und Bodensee wird seit einigen Jahren genau dieses Phänomen beobachtet. Der Sauerstoff von der Oberfläche fehlt dann in der Tiefe wo die Seesaiblinge und Felchen laichen. Hintergründe zur Wasserzirkulation in Seen und mehr zu den Folgen dieser Veränderungen findet ihr im BAFU Dossier zum Weltwassertag vom 22. März 2020: «Am Seegrund wird der Sauerstoff knapp».
Agenda
Workshop des Schweizerischen Fischereiverbands am 9. Mai 2020 in Olten: Mitgliederbestand - abgesagt
Delegiertenversammlung Schweizerischer Fischereiverband - abgesagt
Peak-Kurs «Tag and Track: Den Fischen auf der Spur»
Fischmarkierung ist eine der wichtigsten Methoden zur Untersuchung und Bewirtschaftung von Fischpopulationen sowohl in Fliessgewässern wie auch in Seen. Welche ökologische Fragestellung steht hinter einer Methode und welche Erkenntnisse auf der Individuen- oder Populationsebene und in der zeitlichen Auflösung ergeben sich daraus? Der Kurs beantwortet das Wie, Wann, Wo und Warum der Fischmarkierung. Alle gängigen Markierungsmethoden von optischen Markierungen bis hin zur Fischbiotelemetrie werden vorgestellt. Die Kurstage gliedern sich in einen Theorie-Teil und zwei praktische Teile im Labor und im Feld. Der Kurs findet am 23. Und 24. September statt.