Newsletter 02/2020
Er will nicht als «Vater» des Berner Renaturierungsfonds bezeichnet werden und war es doch ein bisschen. Willy Müller hat sich während 20 Jahren als Geschäftsleiter beim Berner Renaturierungsfonds für naturnahe Gewässer in der Schweiz stark gemacht. Bevor er sich ganz in den verdienten Ruhestand begibt hat ihn die FIBER noch zu einem Interview getroffen. Nicht weniger wichtig ist der lokale Einsatz von motivierten Fischerinnen und Fischern, die sich für Ihre Gewässer einsetzen. Unterstützt werden sie durch die Kampagne «Fischer schaffen Lebensraum» des Schweizerischen Fischereiverbandes, der das bewährte Handbuch für die Praktiker neu aufgelegt hat. Auch diesen Sommer konnten viele Projekte umgesetzt werden um die Gewässer gegen Hitze und Trockenheit widerstandsfähiger zu machen, die Biodiversität zu fördern und Lebensräume für Fische und Fischnährtiere schaffen. In den Bächen und Flüssen steht die Forellen-Laichzeit vor der Tür und wir freuen uns euch den sehr umfangreichen Kartierungsbericht der Laichzeit 2019/2020, die erweiterte und verbesserte FIBER Kartierungs-App und viele andere spannende Beiträge bieten zu können.
Viel Spass beim Lesen und blibed gsund!
Eure FIBER
Laichzeit! Kartierungsbericht 2019/2020
Der Bericht zu euren Kartierungen der Forellen-Laichgruben der letzten Laichzeit ist besonders umfangreich geworden. Ein grosser Dank geht an alle Kartierenden, die mit ihrem freiwilligen Einsatz diese wichtigen Informationen zur Naturverlaichung unserer Forellen beigetragen haben. Im Bericht sind die wichtigsten Eckdaten der einzelnen Kartierungen nach Regionen und neu auch nach Kantonen geordnet zusammengefasst, mit Fotos und Übersichtskarten.
Während der Laichzeit 2019/2020 wurden alle bisherigen Rekorde nicht nur geknackt, sondern die Anzahl der Kartierungen gar verdoppelt! Die Kartierungs-App war damit, trotz gewisser Kinderkrankheiten, ein grosser Erfolg und für die kommende Saison sind wichtige Verbesserungen an der App vorgenommen worden. Es waren über 310 Fliessgewässerkilometer an insgesamt 124 Bächen und Flüssen, die von euch einmalig oder regelmässig während der Laichzeit 2019/2020 observiert wurden. Dabei wurden insgesamt 1460 Laichplätze gezählt.
In verschiedenen Flüssen wurden auch sogenannte Temperatur-Logger eingesetzt, die eine genaue und regelmässige Messung der Wassertemperatur über mehrere Monate erlaubten. Das Ziel war, Zusammenhänge zwischen der Wassertemperatur und der Laichaktivität der Forellen zu untersuchen. Mehr über diese Untersuchungen erfahrt ihr am Ende des diesjährigen Kartierungsberichts.
Erweiterungen und Verbesserungen FIBER Kartierungs-App
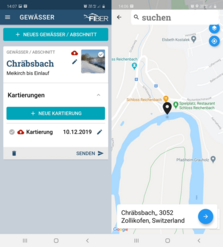
Im vergangenen Winter konnten Laichgruben in den Schweizer Fliessgewässern erstmals digital mit unserer FIBER Kartierungs-App kartiert werden. Für diese Laichzeit haben wir die App erweitert und verbessert.
Im Winter 2019/2020 entfiel erstmals das besonders bei Regen oder Schnee mühselige Ausfüllen der Kartierungsprotokolle mit kalten Fingern. Das digitale Zeitalter hat auch unser Programm «Laichzeit!» erreicht. Mit der FIBER Kartierungs-App liessen sich die Gewässerstrecken und Laichgruben der Forellen einfach per Handy erfassen. Nebst vorwiegend positiver Resonanz und stark gesteigerter Zunahme freiwilliger Kartiererinnen und Kartierer gab es aber auch Raum für Verbesserungen und Erweiterungen. Für die vielen guten Vorschläge und auch Meldungen von Problemen im Zusammenhang mit der Benutzung der App am Gewässer oder mit dem Versand der Daten, sind wir euch sehr dankbar. Diese Erfahrungen aus der Praxis sollten nicht ungenutzt bleiben! Zur bevorstehenden Kartierungs-Saison wurden verschiedene wichtige Verbesserungen und Erweiterungen der App umgesetzt. Durch die Anbindung an einen Server werden eure Kartierungsdaten direkt auf diesem gespeichert und abgeglichen (synchronisiert). Die Kartierungen müssen also nicht mehr an die FIBER gesendet werden, was besonders bei grossem Datenvolumen (vielen Fotos) teilweise Schwierigkeiten bereitete. Besonders praktisch ist neu die digitale Landkarte, auf welcher die Start- und Endpunkte der kartierten Strecke, sowie die Standorte der Laichgruben auch manuell markiert werden können. Dadurch ist sichergestellt, dass auch bei ungenügender GPS-Genauigkeit vor Ort keine falschen Koordinaten erfasst werden, oder diese gar ganz fehlen.
Die App zur Kartierung bei Google Play und im iOS Appstore
FIBER ist neu bei Twitter

Seit Kurzem ist die FIBER auch auf Twitter aktiv. Über unseren Kanal erfahrt ihr Neues aus der Welt der Fische und aus der Fischereiforschung. Speziell für euch Fischerinnen und Fischer haben wir die relevanten Kanäle – Umweltverbände, Fachstellen, Forschende - abonniert und teilen euch ausgesuchte Nachrichten, wegweisende Entwicklungen und neue Erkenntnisse laufend und aktuell mit. In unserer aktuellen Serie tweeten wir über Naturphänomene die unsere lebendigen Gewässer im Wandel der Jahreszeiten prägen.
Folgt dem #JahrderFische auf dem FIBER Twitter Account
Plattform Seenfischerei
Mit Hinblick auf die vielfältigen ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen rund um unsere Seen und die Fischerei wurde im November 2019, an der Tagung «Was ist mit unseren Seen los? – Zukunft der Berufsfischerei auf Schweizer Seen», die Forderung nach einer Schweizer Plattform für den Dialog, den Wissenstransfer und die Bearbeitung konkreter Themen deutlich. Um diesem Anspruch gerecht zu werden gründeten Kantone und Berufsfischer zusammen mit dem Schweizerischen Fischerei-Verband und der Unterstützung durch das durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) die Plattform Seenfischerei. Das Schweizerische Kompetenzzentrum Fischerei (SKF) übernimmt während des ersten Mandats, welches bis Mitte 2023 andauert, die Geschäftsführung.
Weiterführende Informationen zur Plattform Seenfischerei findet ihr in der offiziellen Medienmitteilung des Schweizerischen Berufsfischerverbandes.
Hier könnt ihr mehr zur Tagung «Was ist mit unseren Seen los?» vom November 2019 nachlesen.
Fischer schaffen Lebensraum

Im Praxishandbuch «Fischer schaffen Lebensraum» des SFV werden den Fischerinnen und Fischern die Grundlagen für einfache und kostengünstige Aufwertungsmassnahmen in kleinen Fliessgewässern vermittelt. Das beliebte Handbuch und Nachschlagewerk ist jetzt in einer neuen Auflage erschienen. Eingeflossen sind die vielen Erfahrungen aus zahlreichen Projekten, die in den letzten Jahren von Fischerinnen und Fischern an ihren Gewässern umgesetzt wurden.
Anregungen und Informationen aus umgesetzten Projekten findet ihr auf der Interaktiven Karte
Das Handbuch in der neuen Auflage kann im Onlineshop des SFV bestellt werden
Interview
«Das Bedürfnis nach mehr Raum für die Gewässer verbindet den Hochwasserschutz mit der Ökologie»

Kurt Schmid von der FIBER sprach mit dem kürzlich in den Ruhestand getretenen Willy Müller über seine langjährige Tätigkeit als Geschäftsleiter des Berner Renaturierungsfonds, über die Rolle der Fischer bei Revitalisierungen, die Zusammenarbeit mit dem Hochwasserschutz und über den Baumeister Biber.
Willy Müller (65), geboren und aufgewachsen in Wimmis, Kanton Bern, verbrachte schon in seiner Jungend viel Zeit am Wasser und fischte intensiv an seinen Hausgewässern Simme, Kander und am Thunersee. Nach einer Erstausbildung in analytischer Chemie und Aufenthalten in Nahost und in Afrika absolvierte er die Matura C auf dem zweiten Bildungsweg und studierte Geographie mit Fokus Hydrologie in Bern. Für den Abschluss zog es ihn nach Kenia wo er sich mit Gewässern im Zusammenhang mit der Entwicklungsarbeit beschäftigte. Nach vorerst befristeter Anstellung beim damaligen Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) wurde er 1990 schliesslich beim Berner Fischereiinspektorat angestellt. Im Zuge einer Reorganisation übernahm er ab 2003 die Geschäftsleitung des Berner Renaturierungsfonds. Daneben war er für den Aspekt Renaturierungen im Berner Oberland zuständig. In dieser Zeit half er bei der Wasseragenda21 die Plattform Revitalisierung aufzubauen; später leitete er diese. Der Vater von drei Söhnen und jetzt auch Grossvater tritt nach genau 30 Jahren beim Kanton Bern in den Ruhestand.
Die Projekte des Fonds sind vielfältig und beinhalten Renaturierungen an Flüssen, Bächen, Seen und auch Mooren – Wo liegt der Hauptfokus?
Schon am stärksten auf den Fliessgewässern. Das liegt im Ursprung des Fonds – bei der Gründung waren primär der kantonale Fischereiverband und Umweltverbände beteiligt. Es war damals klar, dass hauptsächlich Gelder zur Verfügung gestellt werden sollen um die durch die Wasserkraftnutzung verursachten ökologischen Schäden zu kompensieren. Wir haben es aber mit der Zeit im Kanton Bern so weiterinterpretiert, dass die gesamte aquatische Zone und ihre Lebensräume umfassender von Revitalisierungen profitieren können. Zuerst ging es dabei mehrheitlich um Auenrevitalisierungen. In den letzten Jahren decken die Projektideen eine immer grössere Vielfalt an Gewässertypen und auch an Feuchtgebieten ab.
Du hast gesagt, dass Geld alleine die Probleme an unseren Gewässern nicht löse, es aber Vieles ermögliche. Wo kann die Finanzierung durch den Fonds bei Gewässerschutzprojekten ansetzen?
Der WWF hat in einer Studie die wichtigsten Stolpersteine in der Umsetzung der Gewässerschutzplanung analysiert. Der Fonds kann verschiedene dieser Schwierigkeiten durch die Finanzierung mildern oder gar beseitigen. Ein sehr wichtiges Instrument ist dabei die Vorfinanzierung, welche oft mit ein paar tausend Franken eine Machbarkeitsstudie ermöglicht. Eine solche ist häufig der Startschuss und dient dabei als erste Diskussionsgrundlage. Zusammen mit der Restfinanzierung am Schluss eines Projekts ist das sicher ein grosser Teil der Erfolgsgeschichte des Fonds.
Geld ist das Eine. Wie gewinnt man die Unterstützung der Gemeinden und der Bevölkerung?
Unabhängig vom Fonds ist das Fischereiinspektorat im Kanton Bern mit den Gemeinden immer im engen Kontakt. Durch die langjährige gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen Persönlichkeiten pflegt man ein gutes Verhältnis und ist «per Du». Das ist ein grosses Plus für die Umsetzung von Projekten. Dagegen sind gewisse Umweltverbände ein «rotes Tuch» bei den Gemeinden und lösen mit ihren Renautrierungsvorschlägen eher Abwehrreaktionen aus. Wir gehe mit dem Thema Revitalisierung eher pragmatisch vor und stellen nicht nur die Ökologie in den Vordergrund. Dabei argumentieren wir mit den Zielen der involvierten Akteure, wie den Gemeinden, deren Aufgabe es ist, den Hochwasserschutz sicherzustellen. Der Raumbedarf steht meistens im Vordergrund und dieses gemeinsame Bedürfnis verbindet den Hochwasserschutz und die Ökologie.
Die Partizipation der Bevölkerung ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Das Erlebnis eines renaturierten oder revitalisierten Gewässers oder Gewässerabschnitts als Naherholung ist oft ein Schlüssel dazu, dass die Bevölkerung so ein Projekt mitträgt und positiv wahrnimmt. Wenn man diesen Aspekt zum Beispiel mit einem Gewässerentwicklungskonzept (GEK) auch in die Massnahmen einbringen kann, ist das äusserst hilfreich. Aktuelle Beispiele dazu sind Revitalisierungen von Seeufern, die seit langem unter hohem Druck stehen. Verschafft man der Bevölkerung durch eine Revitalisierung wieder Zugang zu einem natürlichen Seeufer, wird meistens auch gut verstanden und akzeptiert, dass es nebst einer Badezone auch geschützte Uferbereiche braucht, die nicht betreten werden dürfen. Auch an Fliessgewässern gibt es viele positive Beispiele für solche Synergien.
In mehr als 20 Jahren wurden über 1000 Projekte umgesetzt, eine wahnsinnig hohe Zahl! Welches Projekt lag dir besonders am Herzen?
Viele, jedoch am meisten die grossräumige Renaturierung der Kander. Durch meine persönliche Beziehung zu diesem Fluss hat es mich stets betrübt zu sehen, wie hart dieses Gewässer verbaut ist. Bei Begehungen stellte ich fest, dass an diesem Fluss immer «herumgedoktert» und «herumgeflickt» wurde. Dabei änderte sich aber nie grundsätzlich etwas an den Missständen dieses Systems. Das bewegte mich, unter anderem auch im Ausland nach geeigneten Möglichkeiten zu suchen. In Österreich stiess ich auf das Instrument Gewässerentwicklungskonzept GEK. Darin sah ich eine Möglichkeit, um vielleicht längerfristig am ganzen Fluss eine Veränderung der Situation zumindest diskutieren zu können. Das GEK wurde dann Dank der Überzeugung der damaligen Regierungsrätin, aber auch aufgrund unserer kombinierten Vorgehensweise gutgeheissen und anschliessend sogar in einen verbindlichen Gewässerrichtplan umgewandelt.
Kannst du dieses Projekt «Kander.2050» noch etwas im Detail beschreiben?
Es gab an der Kander auf der einen Seite massive Unterhaltsprobleme und Schutzdefizite aber auch genau so grosse ökologische Defizite. Wenn man schon im Rahmen der Gesetzgebung, die eine integrale Vorgehensweise vorschreibt, Massnahmen trifft, dann sollen gleich alle bestehenden Probleme angepackt und zusätzlich das Bedürfnis der Naherholung miteinbezogen werden. Dieses breite partizipative Verfahren war ein Novum. Basierend auf dem Gewässerrichtplan werden nun sukzessive Massnahmen dort umgesetzt wo die grössten Defizite bestehen. Als gesamtes Paket umfasst dieses Projekt die Flussstrecke von Kandersteg bis zum Einlauf in den Thunersee, also ungefähr 40 Kilometer. Die Umsetzung kann 3-4 Jahrzehnte dauern, da muss man sich keine Illusionen machen. Unsere Gewässer wurden während Jahrzenten dermassen umfunktioniert, dass es jetzt auch viel Zeit braucht um sie wieder einigermassen zu revitalisieren. Den ursprünglichen Zustand wird man jedoch nie mehr wiederherstellen können.
Könntest du den Unterschied zwischen den Begriffen Revitalisierung und Renaturierung etwas genauer erläutern?
Der Unterschied dieser Namensgebung findet sich zum Beispiel in der Gewässerschutzgesetzgebung. Bei den Zielsetzungen steht die Renaturierung im Vordergrund, aber die Massnahmen die man schlussendlich trifft sind mehrheitlich partielle Revitalisierungsmassnahmen. Mein Ziel war immer die Renaturierung – also eine möglichst umfassende Wiederherstellung der ökologischen Funktionen. Als Beispiel dient wieder die Kander. Dort versucht man wirklich auf Abschnitten von mehreren Kilometern die Natur möglichst sich selbst zu überlassen. Immer mit dem Vorzeichen, dass es sich dabei um eine Restwasserstrecke handelt und der Geschiebehaushalt weiter flussaufwärts beeinflusst wird. Aber nichtsdestotrotz handelt es sich um relativ grosse Gewässerräume bei denen man sagen kann, es gehe in die Richtung einer Renaturierung und nicht nur um Revitalisierung. Bei der grossen Mehrzahl der Projekte, die wir unterstützen handelt es sich um Revitalisierungsmassnahmen. Ein Beispiel dafür sind Strukturierungen in Gewässern, sogenannte «Instream» - Massnahmen.
Wie haben sich die Projekte im Laufe der Zeit verändert? Konzentriert sich der Fonds aktuell vermehrt auf grosse Aufgaben?
Natürlich mussten wir uns zu Beginn vor allem auf eher kleinere und mittlere Projekte mit Instream-Massnahmen fokussieren, weil dort ein geringer Widerstand die Umsetzung, vor allem im Rahmen von Vernetzungsprojekten, am ehesten zuliess. Oft gab es Querverbauungen die in die Jahre kamen und ersetzt werden mussten. Das gab uns einen Ansatzpunkt um zumindest durchzusetzen, dass nicht wieder Betonquerwerke, sondern Blockrampen gebaut wurden. Mit den Jahren änderte sich diese Ausrichtung. Besonders die Forderungen nach mehr Raum für die Fliessgewässer öffnete uns die Türen zu grösseren Projekten. Aber, wie man auch unseren Jahresberichten entnehmen kann, war es immer in grosses Anliegen uns nicht nur auf eine Sparte zu konzentrieren, sondern möglichst vielfältige Projekte und mit weiter geographischer Verteilung zu unterstützen. Dieser Anspruch besteht auch seitens der Verbände. Aber es gibt natürlich auch eine gewisse Fremdsteuerung - die Möglichkeiten werden dort genutzt wo sie entstehen. So haben wir, um auf deine Frage zurückzukommen, in den letzten Jahren auch wieder vermehrt viele kleine Projekte umgesetzt.
Du hast eine Fremdsteuerung erwähnt – woher?
Primär immer noch durch den Hochwasserschutz. Auch wenn die strategische Revitalisierungsplanung vorliegt um systematisch die Probleme zu lösen, so zum Beispiel auch bei integralen Projekten die nicht nur den Kanton Bern betreffen, ist es immer noch so, dass das Geld dann fliesst und das Prozedere dann in Gange kommt, wenn Defizite im Hochwasserschutz behoben werden. Es gibt schon eine gewisse Trendänderung hin zu Projekten die fast ausschliesslich ökologisch orientiert sind. Aber auch bei solchen muss trotzdem den Gemeinden oder den Stakeholdern «verkauft» werden, dass schlussendlich auch die Probleme im Hochwasserschutz mitgelöst werden. Langfristig wird man diese Strategie, den durch andere Defizite entstehenden Opportunitäten nachzugehen, beim Renaturierungsfonds wohl weiterhin verfolgen müssen. Auch wenn die Umsetzung vielleicht aus ökologischer Sicht nicht immer sehr strategisch und systematisch ist, erreicht man in 20-30 Jahren trotzdem das strategische Endziel der Renaturierung der Gewässer Gewässerschutzgesetz.
Grössere Projekte werden teilweise kantonsübergreifend umgesetzt, so zum Beispiel das GEK «Sense 21». Entstehen dadurch zusätzliche Hürden und Verzögerungen?
Natürlich ergeben sich schon aus der unterschiedlichen Gesetzgebung der einzelnen Kantone verschiedene Voraussetzungen und somit unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten. Der Kanton Bern hat diesen Fonds, der Kanton Fribourg wiederum nicht. Das schafft ganz klar zusätzliche Herausforderungen die auch beim Projekt «Sense 21» zum Tragen kamen. Dort mussten einige Kompromisse eingegangen werden, bei welchen man aus rein ökologischer Sicht mehr erreichen wollte. Auf der anderen Seite, wenn man solche Projekte nicht gemeinsam anpackt passiert gar nichts. Das Entwicklungskonzept zu «Sense 21» eröffnete, auf noch nicht behördenverbindliche Weise, über die Kantonsgrenze hinweg Möglichkeiten zu Abklärungen, Diskussionen und auch schon zu konkreten Projekten.
Es gibt also auch positive Aspekte – können die Kantone gegenseitig von Erfahrungen profitieren?
Auf jeden Fall! Das stellte ich besonders während den Jahren bei der «Plattform Renaturierung» fest, die es ermöglichte, die Kantone an einen Tisch zu bringen. Dieser Erfahrungsaustausch ist sozusagen ein Muss. Auch wenn uns in der Schweiz die bürokratischen Prozesse manchmal elend kompliziert und langsam vorkommen, gibt es immer Vor- und Nachteile. Persönlich sehe ich, je älter ich werde, darin eher die positiven Aspekte. Früher habe ich mich schon manchmal darüber geärgert, wenn es durch die komplizierten Prozesse nicht möglich war ein Projekt innerhalb eines Jahres bewilligungsreif fertigzustellen und im folgenden Jahr in die Praxis umzusetzen. Bis ein grösseres Renaturierungsprojekt unter Dach und Fach ist kann es locker fünf bis zehn Jahre dauern. Wird es nach diesem Zeitraum baureif, kann es jedoch kaum am Ende noch mit irgendwelchen Einsprachen zu Fall gebracht werden.
Aus welchem Bereich der Gesellschaft oder der Wirtschaft gibt es Widerstand gegen Revitalisierungsprojekte?
Der Hochwasserschutz ist sicher oft die komplexeste Komponente in einem Projekt. Aber am unsaubersten mit Emotionen «spielt» meist die Landwirtschaft. Ich will das nicht pauschalisieren, wir hatten auch sehr positive Erlebnisse. Zum Beispiel hat uns vor vielen Jahren ein Bauer mit grossem Grundbesitz und Gewässerparzellen aus dem Diemtigtal zu sich gerufen, um mehr über die Gewässerrenaturierung zu erfahren und mit uns konkrete Projekte zu erörtern. Aber in der geltenden Landwirtschaftspolitik in der Schweiz wird durch die Subventionen quasi jeder Quadratmeter wie eine Obligation gehandelt. Solange die Fläche und nicht primär das Produkt oder die Leistung eine Rolle spielt, wird die Landwirtschaft einfach ein schwieriger «Player» im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gewässerschutzgesetzes sein. Die organisierte Landwirtschaft torpediert die Umsetzung seit Jahren systematisch, sei es auf Stufe des Parlaments oder der Verbände. Mit dieser Behauptung stehe ich nicht alleine. Ich habe persönlich miterlebt, wie Verbandsvertreter aus der Landwirtschaft bei Sitzungen offen dazu aufgerufen haben auf keinen Fall bei Revitalisierungen mitzumachen, obschon wir, um Synergien zu ermöglichen, parallel zu GEKs auch die landwirtschaftliche Planung initiieren wollten. Selbst das Bundesamt für Landwirtschaft BLW hat in einem offenen Brief klar dazu aufgerufen, dass die Bauern das Instrument «Landwirtschaftliche Planung» nutzen sollen um damit auch zukunftsgerichtet ihre Ressourcen neu planen zu können.
In den Medien erfährt man oft nur von dramatischen Ereignissen wie Jaucheunfällen oder aktuell den Pestiziden in unseren Gewässern. Aber dieser systematische Widerstand seitens der Landwirtschaft gegen Gewässerrevitalisierungen und –renaturierungen ist bei Fischern und der breiten Öffentlichkeit wenig bekannt. Das läuft bewusst unter dem Radar.
Der Fonds wird aus der Wassernutzung gespeist. Entsteht dadurch beim Energiesektor eine gewisse Erwartungshaltung?
Nebst gewissen ausserordentlichen Zuwendungen, zum Teil auch durch Beträge auf freiwilliger Basis, wird der Fonds mit zehn Prozent der Wasserabgaben (Wasserzinsen) finanziert. In einem Dekret ist genau festgehalten, was finanziert werden darf und was nicht. Die Frage, ob die Kraftwerkbetreiber explizite Forderungen gestellt haben, kann ich rückblickend auf mehrere Jahrzehnte ganz klar mit Nein beantworten. Im Gegenteil, speziell auch durch die Ökofonds wie jener des BKW besteht eine sehr enge und persönliche Zusammenarbeit, bis hin zu koordinierten Absprachen zur Aufteilung der Projektfinanzierungen. Das ist allerdings ausschliesslich mit den grossen, professionell geführten Wasserkraftbetrieben der Fall. Bei den kleinen und mittleren ist es genau umgekehrt – dort erfahren wir von gut 80% der Betriebe erbitterten Widerstand. Für Kleinwasserkraftwerke ist die Renaturierung noch immer ein rotes Tuch, ein Feindbild. Durch das Gewässerschutzgesetz, speziell die Gewässerraumsicherung und Minderung der Auswirkungen, stehen die grossen Kraftwerke unter Zeitzwang. Es liegt in deren eigenem Interesse mit der Umsetzung der Massnahmen vorwärts zu machen, um die Vorlagen zu erfüllen.
Welche Erfahrungen hast du mit der aktiven Partizipation der Fischer und anderer Initianten und speziell mit dem Werkzeug «Fischer schaffen Lebensraum» gemacht?
Fischer haben grosse Kenntnisse und eine intensive emotionale Verbundenheit zu ihren Gewässern. Das ist ihre Stärke und dort holen wir sie letztendlich auch ab. Ich wurde dazu in den letzten Jahren oft, unter anderem auch von FIBER, für öffentliche Vorträge angefragt. Ich bin dabei nicht immer gut aufgenommen worden, war aber stets offen und ehrlich. Unsere Stärke beim Fonds ist der direkte Draht zu den Gemeinden und, wie erwähnt, die Mittel um Vorfinanzierungen zu ermöglichen. Diese Werkzeuge haben die Fischer nicht und wenn sie teilweise versuchen, selber direkt Massnahmen zu erzwingen, führt das oft eher zu Widerstand. Wir haben deswegen immer geraten, sich mit Ideen und Anliegen an den zuständigen Fischereiaufseher zu wenden. Er kennt die Verfahren und kann die Chancen eines möglichen Projekts abschätzen. Der Fischereiaufseher ist sozusagen das Nadelöhr durch welches solche Ideen oder auch festgestellte Missstände und ökologische Defizite in die richtigen Kanäle eingespeist werden können.
Gerade vor Kurzem, es war eine meiner letzten Aktionen beim Renaturierungsfonds, haben wir im Saanerland zusammen mit den zuständigen Fischereiaufsehern und dem lokalen Fischereiverein ein Projekt von «Fischer schaffen Lebensraum» direkt umgesetzt. Wir begrüssen diese Art von Initiativen sehr! Aber, weil die Bewilligungsprozesse für Gewässerrevitalisierungen kompliziert und aufwendig sind, ist es zumindest aus meiner Sicht und auch aus der Erfahrung im Kanton Bern der erfolgversprechendste Weg, wenn von Anfang an Fischereiaufseher involviert werden.
Holz oder Stein – welches Baumaterial bevorzugst du in Wasserbauprojekten?
Am liebsten weder noch. Ich bevorzuge, im Sinne einer wirklichen Renaturierung, dem Gewässer mehr Raum zu geben und es sich eigendynamisch selber zu überlassen, ohne mit direkten Strukturierungsmassnahmen einzugreifen. Das ist auch das oberste Ziel des Gewässerschutzgesetzes. Ist dies nicht möglich, dann am besten eine Kombination aus Holz und Stein. Früher konzentrierte man sich vor allem im Oberland auf strukturreiche, jedoch noch immer harte Uferverbauungen und im Gerinne auf Blocksteinformationen, sogenannte «Belebungssteine». Das war vor vielen Jahren in Gebirgsbächen das Höchste der Gefühle. Aktuell versucht man vermehrt mit einer Kombination zu arbeiten, bei welcher Stein und Holz durchbohrt und mit Gewindeeisenstäben verschraubt werden. Mit dieser technischen Weiterentwicklung, die zu mehr Lagerstabilität bei Totholz führt, versucht man derzeit im konventionellen, harten Hochwasserschutz vermehrt Strukturelemente in die Gewässer einzubringen. Trotzdem hat Totholz gerade im Oberland immer noch einen schweren Stand. Bei Hochwasser-Grossereignissen in den letzten Jahren war das immer ein riesiges Thema. Betrachtet man die Analysen zur Herkunft des Holzes welches zu Problemen führte, stellt man jedoch meistens fest, dass es sich nicht um bereits im Gewässer vorhandenes Totholz handelte. Das Holz gelangte durch Erdrutsche und Murgänge, bei welchen oft ganze Hangparteien betroffen waren, ins Gewässer.
Apropos Holz: 2014 hat das BAFU die Praxisanleitung «Biber als Partner bei Gewässerrevitalisierungen» publiziert. Der Biber seither schon viele neue Gewässerabschnitte zurückerobert. Wer war der Biber für dich, ein Mitarbeiter oder eher ein Gegenspieler?
Die Praxisanleitung die du ansprichst ist beim Renaturierungsfonds auf volle Unterstützung gestossen. Ich weiss, dass der Biber in Fischereikreisen nicht nur einen guten Ruf geniesst. Das nicht aus Konkurrenzgründen – er frisst ja keinen Fisch wie der Otter – aber er ist ein Mitspieler der nun plötzlich auch die Gewässerlebensräume umgestaltet. Als der Biber in unseren Breitengraden noch sehr verbreitet war, sahen unsere Gewässerlandschaften wohl markant anders aus. Und die heimische Fischfauna entwickelte sich auch unter diesem Regime sehr gut. Inzwischen wurden beim Fonds auch verschiedene Projekte sozusagen mit Hilfe des Bibers umgesetzt, zum Beispiel an der Bibera. Dort war es möglich, mit entsprechenden Entschädigungen für die Landwirtschaft Raum zu gewinnen und den Biber walten zu lassen. Die Strategie beim Renaturierungsfonds ist es, den Biber wo immer möglich zu tolerieren. Aber es ist stimmt schon, dass die Situation je nach Region sehr unterschiedlich sein kann. Im Berner-Oberland kommt der Biber jetzt erst richtig an, während er in den Kantonen des Mittellands schon sehr weit auf dem Vormarsch ist. Und leider manchmal auch Probleme verursacht.
Es gibt noch viel zu tun… Wirst du nach deiner Pensionierung weiter aktiv beim Fonds bleiben, eventuell in beratender Funktion?
Ich wurde oft darauf angesprochen mit Aussagen wie: «Du kannst doch jetzt nicht wirklich aufhören!». Aber ich habe immer klar gesagt, dass ich nicht nur kann, sondern aufhören muss und auch will. Mein Nachfolger ist ein langjähriger Arbeitskollege, er und das Leitungsteam des Renaturierungsfonds werden vielleicht ein paar andere Schwerpunkte setzen. Aber die Kontinuität des Fonds ist absolut gegeben, rein schon von den Strukturen und Rahmenbedingungen her. Ich sehe bei anderen Leuten, dass sie sich auch noch zehn Jahre nach ihrer Pensionierung noch einmischen und denken, dass sie immer noch systemrelevant seien. Diesen Fehler sollte man nicht machen. Wenn ich angefragt werde mich zu äussern ist es etwas Anderes, aber ich werde mich auf keinen Fall aufdrängen.
Irgendwann muss Schluss sein. Gibt es ein Schlusswort von dir?
Renaturierung und Revitalisierung ist durch die äusserst breite Quervernetzung über verschiedene Bereiche sehr spannend. Früher wollte man im Wasserbau möglichst verhindern, dass aus anderen Bereichen ebenfalls mitgeredet wird, das hat sich komplett geändert. Der Prozess zu mehr Partizipation ist aber noch nicht abgeschlossen. Aber es sollen und dürfen heute viel mehr Interessengruppen bei der Gewässergestaltung mitreden. Ich finde es deswegen auch wichtig und gut, dass sich die Fischer und ihre Organisationen einbringen. Es gibt gewisse Parallelen zum Thema Fischbesatz, dort vollzieht sich auch ein Wandel, der Zeit braucht. Die Initiative «Fischer schaffen Lebensraum» geht absolut in die richtige Richtung. Vielleicht als passender Schlusssatz darf man festhalten, dass die Fischer im Gewässerschutz ein sehr wichtiger «Player» sind und es auch bleiben werden. Die Fischer und ihre Organisationen konnten in den letzten Jahren und Jahrzehnten durch ein grosses Engagement sehr viel in der schweizerischen Gesetzeslandschaft bewegen, vor allem auf nationaler, aber eben auch auf kantonaler Ebene - bei uns in Bern ist der Renaturierungsfonds ein sehr gutes Beispiel dafür.
Im Namen der Fischereiberatung und der Schweizer Fischer und Fischerinnen danken wir dir für das Interview und dein grosses Engagement für unsere Gewässer und Fische. Wir wünschen dir für deinen Ruhestand viel Gesundheit und Freude, sei es mit deinen Enkelkindern oder beim Fischen.
Ich danke euch, die Gewässer werden mich auf jeden Fall mein Leben lang nicht mehr loslassen. Ich wünsche der Fischereiberatung viel Erfolg!
Publikationen
Berechnung von Schäden bei Fischsterben in Fliessgewässern
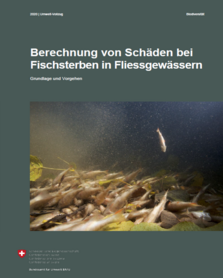
In der Schweiz kommt durchschnittlich alle zwei Tage zu einem Fischsterben. Massnahmen zur Wiederherstellung des Lebensraumes nach einer Verschmutzung können dabei dem Verursacher in Rechnung gestellt werden. Welche Schäden und Aufwände berücksichtigt und wie sie berechnet werden können zeigt die BAFU Publikation. Sie dient den kantonalen Fachstellen als einheitliche Berechnungsgrundlage und wurde an das heutige Fischereimanagement angepasst. Die aktuelle Auflage berücksichtigt nun stärker auch die ökologischen Zusammenhänge in Gewässern. So können neu auch Schäden an Fischnährtieren wie dem Makrozoobenthos, welche nicht in der klassischen Berechnung des Ertragsverlusts berücksichtig werden, verrechnet werden.
Publikation «Berechnung von Schäden bei Fischsterben in Fliessgewässern»
Blaualgen in Schweizer Seen
Blaualgen, korrekt sind es Cyanobakterien, gehören zu den ältesten Formen des Lebens auf der Erde. Sie kommen sowohl im Wasser als auch an Land sehr häufig vor. Unter ganz besonderen Bedingungen können sie sich in Seen massenhaft verbreiten und an der Seeoberfläche quasi aufrahmen. Man spricht dann von einer Blüte. Weil es unter den mehreren tausend Arten solche gibt, die toxische Substanzen produzieren können, stellen sich viele Fragen. Antworten geben die Forschenden der EAWAG.
Hier geht’s zum Frage-Antwort Katalog zum Thema Cyanobakterien
Flohkrebse: Wundersamer Zuwachs an Biodiversität
Sie sind wertvolle Arbeitstiere in unseren Fliessgewässern. Bachflohkrebse zerkleinern Laub und Pflanzenmaterial und fressen dabei eigentlich nur mikroskopisch kleine Lebewesen. Und sie sind selber wiederum wichtige Nährtiere für unsere Fische. Bis vor kurzem ging man von rund 20 Flohkrebsarten aus, die in der Schweiz heimisch sind. Ein Projekt des Wasserforschungsinstituts Eawag und der Universität Zürich hat nun gezeigt, dass es über 40 Arten sind. Genau hinschauen lohnt sich, denn nur was man kennt, kann auch geschützt werden.
Mehr über die Diversität der Flohkrebse
Hier geht’s zum Video auf Youtube über das Projekt Amphipod.ch (Eawag, Jonas Steiner, Andri Bryner, 4min)
Mikroplastik in der Umwelt
Der Verfahrenstechniker Adriano Joss vom Wasserforschungsinstitut Eawag beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Kläranlagen und der Entfernungen von Mikroverunreinigungen aus dem Wasser. Gemeinsam mit dem Leiter des Eawag-Partikellabors Ralf Kägi hat er den aktuellen Stand des Wissens zum Thema Mikroplastik zusammengetragen.
In einem Interview stellt er die wichtigsten Erkenntnisse vor
Ausführliche Informationen wurden neu auf der Webseite «Mikroplastik in der Umwelt» von der Eawag zusammengestellt.
Agenda
Workshop «Mitgliederbestand» des Schweizerischen Fischereiverbands am 24. Oktober 2020 in Burgdorf
Nach der Pandemie-bedingten Absage am Anfang dieses Jahres führt der SFV seinen Workshop zu Massnahmen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Mitgliederzahlen in Vereinen und Verbänden am den 24. Oktober 2020 von 9:30 bis 16 Uhr im Schloss Burgdorf durch. In der Schweiz besitzen im Jahr 2019 rund 150‘000 Personen einen Sachkundenachweis Fischerei, und jährlich kommen rund 8000 Neufischerinnen und Neufischer dazu. Trotzdem zählt der Schweizerische Fischerei-Verband SFV gleichbleibend rund 30‘000 Mitglieder. Es ist kein Zuwachs erkennbar – dies will der SFV ändern und die steigende Beliebtheit am Fischen in steigende Mitgliederzahlen ummünzen. Zu diesem Zweck veranstaltet er am 24. Oktober 2020 einen Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern aus Vereinen und Verbänden aus allen Schweizer Kantonen.
Hier geht’s zum SFV-Workshop «Mitgliederbestand»
Eawag PEAK-Kurs «Planung und Bau von Fischwanderhilfen» 28. – 29. Oktober 2020 in Aarau und Dübendorf
Die Gewässerschutz- und Fischereigesetzgebung verlangt, dass bis 2030 die freie Fischwanderung wiederhergestellt werden muss. Die strategische Planung hat gezeigt, dass bei mehr als 1 000 Anlagen Massnahmen ergriffen werden müssen. Dieser Kurs vermittelt die rechtlichen und fachlichen Grundlagen zur Planung und zum Bau von Anlagen zur Sicherstellung der freien Fischwanderung (Fischaufstieg, Fischabstieg, Fischschutz). Anhand von konkreten Fallbeispielen aus der Praxis werden Planung und Realisierung von Sanierungsprojekten aufgezeigt und diskutiert. Der Kurs richtet sich an Fachleute der Kantone, der Wasserkraftbranche sowie an Mitarbeitende von Ingenieur- und Ökobüros und NGO’s. Er eignet sich für Einsteiger in die Thematik als auch für Fortgeschrittene mit wenigen Jahren Erfahrung.
Hier gibt es weitere Informationen zum PEAK-Kurs
Passiun – Messe für Jäger, Fischer und Schützen am 5. Bis 7. Februar 2021 in Chur

Alle zwei Jahre findet PASSIUN, die Messe für Jäger, Fischer und Schützen unter der Leitung der Expo Chur AG statt. Die Messe ist ein nationaler Branchentreffpunkt für Jagd-, Fischerei- und Schiesssport-Begeisterte. Auch für uns Fischer wird es einen interessanten Mix aus fachspezifischen Ausstellern, Sonderschauen, Referaten und anderen Attraktionen geben.
Hier geht’s zur Webseite der Passiun